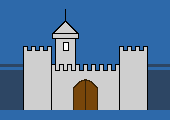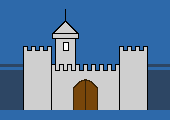|
|
Beschreibung
Mockritz ist ein Ortsteil der Gemeinde Großweitzschen im Norden des Landkreises Mittelsachsen und liegt zwischen Oschatz und Döbeln.
Das Rittergut befindet sich in einer Niederung neben dem ehemaligen Schlossteich und der Dorfkirche. In dem aus einer Wasserburg hervorgegangenen Herrenhaus saßen viele bekannte Adelsfamilien der Mark Meißen. Die auf Pfählen errichtete Wasserburg war von allen Seiten mit Teichen und Wallgräben umgeben, die später, u.a. bei der Erweiterung des Gutshofes und dem Neubau der Wirtschaftsgebäude, zugeschüttet wurden und damit die Befestigungsanlagen verwischt haben.
Bereits 1231 tauchten Christianus de Mokeruz und sein Bruder Iohannes in einer Urkunde des Bischofs Heinrich von Meißen auf. Bis 1590 gehörte der Ort den Marschällen von Mockritz, die ihren Namen nach dem erblichen Marschall- und Kämmereramt der Markgrafen von Meißen führten und eng mit den Marschällen von Bieberstein verbunden sind. Als gegen Ende des 16. Jahrhunderts die Mockritzer Linie der Marschälle ausstarb, wechselten in den folgenden Jahren häufig die Besitzer. Zunächst kam das seit 1551 als Rittergut bezeichnete Anwesen 1590 an die Familie von Pontzschmann. 1663 wurde der kursächsische Rittmeister und Oberstleutnant Joachim von Dürfeldt mit Mockritz belehnt, dessen Sohn 1698 das Herrenhaus durch den Anbau eines Flügels erweiterte. 1719 erwarb der aus dem rheinischen Adelsgeschlecht stammende Philipp Adam zu Eltz das Gut, der es wenige Jahre später wiederum an seinen Neffen Anton Gottlieb Christoph von Hardenberg vererbte. 1788 kaufte der Mittweidaer Kaufmann und spätere Freiherr Johann Gottfried Lorenz das Rittergut. Über Christian Friedrich Kunert aus Schieritz gelangte das Gut 1856 schließlich an den sächsischen Kammerherrn und Landtagsabgeordneten Otto Ludwig Christoph von Schönberg. Hendrik Camp von Schönberg, ein Enkel Ottos von Schönberg, wurde 1945 enteignet und verbrachte neun Jahre in sowjetischer Kriegsgefangenschaft, bevor er in den Westen ausreisen durfte.
Im Zuge der Bodenreform begann man mit dem Abriss des Herrenhauses. Das Dach, Mansardenstockwerk und ein Teil des Flügels aus dem 17. Jahrhundert mussten weichen. Doch Proteste der Einwohner verhinderten dessen gesamte Vernichtung und führten 1959 sogar zur Rekonstruktion des Bauwerks, wenn auch unvollständig und in vereinfachten Formen. Mit der politischen Wende 1989 gab es für die Familie von Schönberg dann wieder die Gelegenheit, ihren alten Besitz zurückzuerwerben. Theda Camp von Schönberg, die 1956 den aus einer ostpreußischen Adelsfamilie stammenden Eberhard von Kuenheim heiratete, erwarb 1993 den nicht aufgesiedelten Teil des ehemaligen Rittergutes und ließ in den 1990er Jahren umfangreiche Sanierungsarbeiten durchführen.
Der ehemalige Rittergutshof stellt sich als offener Hof auf unregelmäßigem Grundriss dar. Seine westlichen Wirtschaftsgebäude wurden abgerissen. Dem noch vorhandenen Herrenhaus, ein rechteckiger Renaissancebau aus dem 16. Jahrhundert mit Mansardwalmdach, dem ein festes von Wasser umgebenes Haus mit Wehrtürmen vorausgeht, fügte man 1698 einen weiteren Flügel im spitzen Winkel hinzu. Dieser Erweiterungsbau, ein zweigeschossiger Putzbau mit heute vereinfachtem, ehemals jedoch dominantem Mansardwalmdach, besitzt in der Mittelachse eine gewölbte Durchfahrt mit Korbbogentor. Über dem Tor befand sich das Allianzwappen derer von Dürfeldt und von der Gablentz sowie die Inschrift "G. H. v. Dürfeldt / A. M. v. Gablentz / 1698", bezugnehmend auf Georg Heinrich von Dürfeldt und seiner Ehefrau Anna Maria von Gablentz. Das über die Jahre stark verwitterte Wappen wurden im Juni 1996 durch einen neuen Schlussstein ersetzt, der die Wappen derer von Kuenheim und von Camp zeigt. Zum Tor führte einst eine von Mauern gefasste Zufahrt mit schießschartenartigen Öffnungen. An der Hofseite des Torhausflügels befindet sich ein Gang mit fünf offenen Bogenarkaden. Ein Sitznischenportal an der Hofseite ist mit Beschlagwerk und toskanischen Halbsäulen verziert und mit der Jahreszahl 1698 datiert.
Im nördlichen Bereich des Hofes schließt sich ein großes, zweigeschossiges Wirtschaftsgebäude mit Walmdach aus dem 18. Jahrhundert an. In dem Haus wurde früher Getreide gelagert. Das gewölbte Erdgeschoss diente als Kuhstall. Heute bewohnt das Ehepaar von Kuenheim das restaurierten Bauwerk. Bemerkenswert ist eine zweigeteilte, barock anmutende Treppenanlage, mit der man das Obergeschoss erschließt.
|
|
| |
| Bildergalerie |
|---|
|
 |
| Rittergut Mockritz |
|