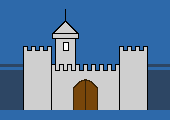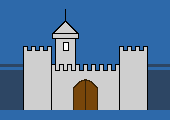|
|
Beschreibung
Orte mit dem Namen "Arnsdorf" gibt es in Sachsen mehrere. Das hier beschriebene Arnsdorf befindet sich südlich der Bundesautobahn 4 an der Anschlussstelle Nieder-Seifersdorf im sächsischen Landkreis Görlitz. Eine urkundliche Erwähnung Arnsdorfs erfolgte 1366 im Görlitzer Stadtbuch als Arnoldisdorf. Das Dorf ist vermutlich jedoch schon wesentlich älter, denn die nur wenige hundert Meter östlich vom Rittergut gelegene St.-Katharinen-Kirche stammt wahrscheinlich schon aus der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts.
Die erste urkundliche Erwähnung des Rittergutes in Arnsdorf datiert aus dem Jahr 1525. Kurz darauf erwarb Johannes von Gersdorff die beiden Rittergüter Arnsdorf und Hilbersdorf. Er selbst wohnte jedoch nur auf dem Schloss Döbschütz, das als eines der ältesten Schlösser der Oberlausitz und als Stammhaus des Adelsgeschlechtes Debschitz gilt. Das Adelsgeschlecht von Gersdorff mit gleichnamigem Stammhaus in Gersdorf in der Oberlausitz zählt zum deutschen Uradel. Die Familie war vor allem in der Oberlausitz und in Sachsen ansässig, verfügte aber auch in der Niederlausitz, in Schlesien und in Böhmen über umfangreichem Landbesitz. Kein anderes Oberlausitzer Adelsgeschlecht hat sich so stark verzweigt und so zahlreiche Güter erworben. Angehörige standen seit dem 14. Jahrhundert in Diensten verschiedener Fürsten, insbesondere der böhmischen Könige und der benachbarten Kurfürsten von Sachsen. Einzelne Zweige der Familie von Gersdorff wurden zu Freiherren und Reichsgrafen erhoben.
Neben den Herren von Gersdorff gehörte Arnsdorf auch den Adelsgeschlechtern von Warnsdorf und von Nostitz. Die zu Freiherren erhobenen Herren von Warnsdorf gehörten zu einem Adelsgeschlecht, das im nördlichen Böhmen und seit dem 12. Jahrhundert auch in der Lausitz und Meißen siedelte. Ihr Hauptsitz war das im 14. Jahrhundert erstmals erwähnte Dorf Warnsdorf, die heutige Stadt Varnsdorf in Tschechien.
Arnsdorf kam 1789 an die Familie von Wiedebach und Nostitz-Jänkendorf, als der königliche Kammerherr Johann Carl Gottlob von Nostitz auf Wiesa das Gut Arnsdorf zusammen mit dem Gut in Hilbersdorf kaufte. Die Familie entstammte der Jänkendorfer Linie des Geschlechts von Nostitz. Gottlob von Nostitz hatte Rechtswissenschaften an der Universität Wittenberg und später an der Universität Leipzig studiert und unterstützte Kirchen, Schulen, Arme und Notleidende seiner aber auch die anderer Gemeinden. Für seine Verdienste erhielt er von König Friedrich Wilhelm III. den roten Adlerorden dritter Klasse. Da seine Söhne vor ihm starben, vermacht er seinem Enkel, Carl Friedrich Erdmann von Wiedebach und Nostitz-Jänkendorf, die Güter Arnsdorf und Hilbersdorf. Carl Friedrich Erdmann von Wiedebach erhielt 1834 durch König Friedrich Wilhelm III. auch die Genehmigung zur Namens- und Wappenvereinigung von Wiedebach und Nostitz-Jänkendorf. Unter Carl Friedrich Erdmann von Wiedebach und Nostitz-Jänkendorf wurde 1856 auch das im Kern aus dem 18. Jahrhundert stammende Herrenhaus umgebaut. Das Bauwerk, wegen seiner stattlichen Größe stets als "Schloss" bezeichnet, ist ein massives, verputztes, zweigeschossiges Haus auf rechteckigem Grundriss mit ausgebautem und an den Giebelseiten abgewalmtem Dach. Zum schlichten Eingang an der nördlichen Hofseite gelangt man über eine von Bruchsteinmauern eingefasste halbkreisförmige Wagenauffahrt. An der südlichen Gartenseite ist ein Balkon vorgebaut.
Ca. 100 Meter südlich vom Schloss erhebt sich der langgestreckte zweigeschossige Bau der früheren Schlossgärtnerei. Das in der 2. Hälfte des 18. Jahrhunderts errichtete Haus in barocken Formen sieht mit seinem markanten Mansardwalmdach und den drei mittleren als Risalit hervorgehobenen Fensterachsen selbst wie ein Schloss aus. Verstärkt wird dieser Eindruck durch die drei gleich gestalteten Rundbogenportale mit Wellengiebel und Einfassungen aus Granit auf der nördlichen Gartenseite. Auf der Südseite verraten drei seitlich angeordneten großen Rundbögen die Nutzung als ehemalige Orangerie. Zwischen dem Schloss und der Orangerie ist die ehemalige barocke Parkanlage in ihren Grundformen noch erhalten.
Carl Friedrich Erdmann von Wiedebach und Nostitz-Jänkendorf starb 1873 als hochgeachteter Mann in Arnsdorf. Sein Besitz in Arnsdorf und Hilbersdorf ging an seinen Sohn, den Landeshauptmann des preußischen Markgrafentums Oberlausitz und ab 1899 Präsidenten der Oberlausitzischen Gesellschaft der Wissenschaften Paul Friedrich von Wiedebach und Nostitz-Jänkendorf. Über Harry von Wiedebach und Nostitz-Jänkendorf und dessen Tochter Irmgard, die 1932 den Landwirt Hans-Heinrich Schnorr von Carolsfeld heiratete, kam Arnsdorf an die eigentlich im westlichen Sachsen beheimatete Familie Schnorr von Carolsfeld. Das bekannte Geschlecht geht zurück auf den aus Schneeberg stammenden Hammerherrn Veit Hans Schnorr, dem unter anderem die Hammerwerke in Auerhammer und Carlsfeld gehörten und dessen Angehörige im 17. und 18. Jahrhundert das Berg-, Hammer- und Hüttenwesen im Erzgebirge maßgeblich prägten. Veit Hans Schnorr wurde am 4. April 1687 durch Kaiser Leopold I. mit dem Prädikat "von Carolsfeld" in den Reichsadelsstand aufgenommen.
Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges fiel das Rittergut unter die Bodenreform. Das Arnsdorfer Schloss nahm fortan einen Kindergarten, eine Zahnarztpraxis, den Jugendclub des Ortes und Wohnungen auf. Der Hof wurde durch eine Landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaft bewirtschaftet. Als nach den politischen Veränderungen in der DDR eine Rückkehr der Familie Schnorr von Carolsfeld möglich wurde, kaufte Hansheinrich Schnorr von Carolsfeld, ein Enkel des Harry von Wiedebach, ab 1996 zunächst die umgebenden Waldflächen, 1998 die Orangerie und 2004 auch das Schloss zurück. Zwischenzeitlich sind sowohl die Orangerie als auch das Schloss umfangreich saniert und zu Wohnungen umgebaut worden, worüber die Inschrift "H. S. v. C. / 2000" im Schlussstein der Mitteltür der Orangerie und die Inschrift "H. S. v. C / 2007" unter dem Wappen der Familie von Wiedebach und Nostitz-Jänkendorf an der Eingangstür des Schlosses hinweisen.
|
|
| |
| Bildergalerie |
|---|
|
 |
| Schloss Arnsdorf |
|
 |
| Orangerie Arnsdorf |
|