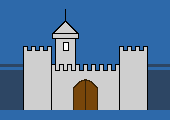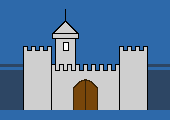|
|
Beschreibung
Crostau ist ein Ort im Landkreis Bautzen und liegt inmitten des Oberlausitzer Berglandes auf einer Höhenlage von 245 bis 380 Metern. Der Ort Crostau unterteilt sich in Niedercrostau um die ehemalige Wasserburg Kroste und Obercrostau mit dem Dorfplatz am ehemaligen Rittergut und der Crostauer Kirche. Crostau und seine Ortsteile liegen auf altem Siedelland auf dem in Niedercrostau die sorbischen Milzener wahrscheinlich bereits um 800 n. Chr. siedelten. Auf eine frühe Besiedlung weisen Bodenfunde und Urnenteile aus der Bronzezeit hin. Mit der deutschen Landnahme ab dem 10. Jahrhundert wurde eine ältere Befestigung zu einer kleinen Wasserburg, der "Kroste", ausgebaut.
Wasserburg "Kroste"
Über die Wasserburg in Niedercrostau gibt es nur wenige Informationen. Schriftliche Überlieferungen aus dieser Zeit sind natürlich nicht vorhanden und so können nur Vermutungen angestellt werden, die durch Ausgrabungen des Crostauer Lehres und Heimatforschers Schöne in den Jahren 1897 und 1908 gestützt werden. Bei den Ausgrabungen fand man u.a. eiserne Lanzenspitzen, ein Tongefäß und Mauerreste, die Auskunft über die einstige Burganlage geben. Cornelius Gurlitt hat diese zeitnah in seiner "Beschreibenden Darstellung der älteren Bau- und Kunstdenkmäler des Königreichs Sachsen" zusammengefasst. Demnach soll die Gesamtfläche der Anlage ca. 40 x 26 m betragen haben. Die Wasserburg selbst bestand aus einem turmartigen, in den Obergeschossen wohl in Lehmfachwerk ausgeführten Gebäude mit bis zu 125 cm dicken Mauern und einer Feuerstelle. Umgebende Gräben und ein Wall im Osten und Norden schützten die Anlage, wobei der nördliche Wall durchbrochen war. Eine stark fließende Quelle füllte den Graben, dessen Wasser über den nördlichen Walldurchbruch abfließen konnte, aber auch zum Anstauen Verwendung fand.
Immer wieder wird in der Burg ein "Raubschloss" vermutet, dass, wie die nahe Burg Körse, 1352 durch den Sechsstädtebund zerstört worden sein soll. Konkrete Beweise gibt es hierzu jedoch nicht und natürlich wurden Burgen auch nicht als Raubburgen errichtet. Heimatforscher gehen davon aus, dass die Burg wohl durch deutsche Ritter angelegt worden ist und in enger Verbindung zur Körse, die eine Art Hauptburg darstellte, möglicherweise die nahen Handelswege "Salzstraße" und "Marktstraße" als Geleitburg sicherte. Ihre Wehrhaftigkeit war jedoch geringer als die der Körse. Ob es wegen fehlender Einnahmen beim Geleit vorüberziehender Kaufmannszüge tatsächlich zu Überfällen oder Lösegeldforderungen der Burgherren kam, muss offen bleiben. Fest steht, dass die Zeit der Kroste im 14. Jahrhundert zu Ende ging und der Rittersitz danach südlich auf den Berg verlegt wurde.
Rittergut Crostau
Leider gibt es auch zur Entwicklung des Ortes Crostau keine zeitlichen Hinweise. Manchmal wird die Zerstörung der Kroste im Jahr 1352 als Ersterwähnungsjahr bezeichnet, obwohl Crostau selbst erstmals 1419 als Crostow in einem Steuerverzeichnis der Stadt Bautzen urkundlich eine Erwähnung fand. Auch der Bau des Crostauer Herrenhauses verbirgt sich im Dunkeln. Vermutungen zur Entstehung der Gutsanlage gehen in die Zeit um oder nach 1500, denn im "Handbuch des Oberlausitzer Adels und seiner Güter" beschreibt Prof. Herrmann Knothe den Verkauf eines Zinses zu Krostau durch Balthasar von Nadelwitz und Wurschen im Jahr 1504. Über die Familie von Griesslau erwarb der kaiserliche Rat und spätere Landeshauptmann der Oberlausitz Ernst von Rechenberg Mitte des 16. Jahrhunderts die Herrschaft. Mit ihm begann eine rund 100 Jahre währende Ära der Rechenbergs in Crostau. In diese Zeit des meißnischen Uradelsgeschlechts fällt auch der Bau des Herrenhauses.
1668 gelangte Crostau an Christian Wilhelm von Watzdorf und nach dessen Tod an seinen Sohn Christoph Heinrich von Watzdorf. Wie viele seiner Familienmitglieder stellte sich auch Christoph Heinrich von Watzdorf in den Dienst der Wettiner und stieg zum königlich-polnischen und kurfürstlich-sächsischen Kabinettsminister und wirklichen Geheimen Rat sowie zum Obersteuereinnehmer und Generalakzisedirektor auf. Er gehörte somit zu den einflussreichsten Herren am Hof Augusts des Starken. Aufgrund seiner Verdienste um den sächsisch-polnischen Staat wurde er 1719 in der Reichsgrafenstand erhoben. 1729 ging Gut Crostau in der Erbfolge an seinen Sohn, den Hof- und Justizrat Christian Heinrich von Watzdorf, welcher der Crostauer Kirche 1732 eine von Gottfried Silbermann gebaute Orgel stiftete. Aber Christian Heinrich von Watzdorf hatte auch negative Seiten. Neben privaten Vergehen und einem persönlichen Konflikt mit dem späteren kurfürstlich-sächsischen und königlich-polnischen Premierminister Heinrich von Brühl versuchte der Domherr zu Meißen und zu Naumburg sowie Dompropst zu Bautzen auch die Domherren außerhalb der landesherrlichen Gerichtsbarkeit zu stellen und fiel damit beim sächsischen Kurfürsten Friedrich August II. endgültig in Ungnade. Watzdorf wurde im April 1733 verhaftet und bis zu seinem Tod 1747 auf der Festung Königstein gefangen gehalten. Alle seine Besitzung und Vermögenswerte zog man ein, darunter auch das Gut Crostau und eine wertvolle Bibliothek mit ca. 8.000 Bänden im Crostauer Herrenhaus.
Unter der Familie von Watzdorf kam es aber auch zum Ausbau des Herrenhauses zu einer barocken Dreiflügelanlage, von der ein Flügel die Watzdorfsche Bibliothek beherbergte. Die Dreiflügelanlage bestand jedoch nur 100 Jahre. 1819 brach man die Seitenflügel wieder ab. Darüber hinaus umgaben mehrere Gartenanlagen, die den gesamten Berghang einnahmen, das Herrenhaus. Der Hang war durch Terrassen und Wasserspiele untergliedert. Eine Sichtachse zielte auf das Herrenhaus. Auch ein alter Baumbestand und zwei Fontänen mit zehn und zweiundzwanzig Ellen Höhe wurden hervorgehoben. Zwischen Herrenhaus und Kirche befanden sich ein Küchengarten, ein Gewächshaus und eine Orangerie, in der über 600 Orangenbäume aufbewahrt worden sein sollen. Weiterhin gehörten zum Gut ein Obstgarten mit ca. 1.000 Obstbäumen und eine Brauerei.
Nach dem Sturz von Christian Heinrich von Watzdorf wurde Crostau von dem Landesherrn in ein Kammergut umgewandelt und von einem Administrator bewirtschaftet, bis 1755 Graf Hermann Carl von Keyserlingk, ein deutsch-baltischer Diplomat in russischen Diensten und von 1733 bis 1745 russischer Gesandter in Dresden, die Güter Crostau, Eulowitz, Bederwitz und Rhodowitz kaufte. Sein Sohn, Heinrich Christian von Keyserlingk, veräußerte die Güter 1770 an den Reichsgrafen Andreas von Riaucour, der damit seine Besitzungen in der Oberlausitz abrundete. Der Sohn des aus einer lothringischen Familie stammenden Warschauer Bankiers und kursächsischen Kammerrates Peter Riaucour war Geschäftsträger des Kurfürsten von Sachsen am Kurpfälzischen Hof in Mannheim. Sein Vater hatte bereits 1751 das Rittergut Putzkau und 1766 Gaußig erworben und vergrößerte seinen Besitz durch umfangreiche Zukäufe. Die bürgerliche Familie stieg erst 1741 in den erblichen Adelsstand auf. 1754 erfolgte die Erhebung in den Reichsgrafenstand.
Nach dem Tod des Reichsgrafen erbte seine älteste Tochter Henriette den Grundbesitz. Da sie mit dem aus Mannheim stammenden kurpfälzischen Gesandten am kursächsischen Hof Graf Carl Theodor von Schall zu Bell verheiratet war, führte sie fortan den Namen "von Schall-Riaucour". Familiensitz war jedoch nicht Crostau, sondern das Schloss in Gaußig. Obwohl die Familie von Schall-Riaucour nur selten in Crostau weilte, wurden dennoch verschiedene Änderungen vorgenommen. So ließ die Gräfin Henriette von Schall-Riaucour 1805 Herrenhaus und Park erneuern. 1819 brach man die beiden Seitenflügel ab und im Jahre 1860 erfolgte der Umbau des Herrenhauses im Stil der deutschen Renaissance. Dabei erhielt das Satteldach schmuckreiche Volutengiebel und Dachgauben. An der Gartenseite des Hauses errichtete man einen Turm mit spitzer Haube. Der Park erfuhr eine Umwandlung in einen englischen Landschaftspark.
Ende des 19. Jahrhunderts wurde das Haus nur noch selten von der Familie Schall-Riauchour genutzt und war längere Zeit verpachtet. Schließlich verschenkte Adam Graf von Schall-Riaucour das Gebäude an die NS-Volkswohlfahrt, die darin ein Müttererholungsheim einrichtete. Später diente das Haus auch als Lazarett. Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges richtete man in den Räumen ein Krankenhaus ein, das bis 1991 bestand. 1992 wurde der einstige Herrensitz privatisiert, doch der Plan, hier ein Kurhotel einzurichten, nie realisiert. Schließlich wurde der Kaufvertrag 1997 rückgängig gemacht und das Herrenhaus fiel wieder der Gemeinde zu. Nach einem Brand 1999 schien keine Hoffnung mehr für das leerstehende Haus aufzukommen, aber 2001 konnte die Gemeinde den abgebrannten Adelssitz doch noch verkaufen. Zwischenzeitlich sind bereits umfangreiche Sanierungsarbeiten innen und außen erfolgt und auch der Park soll in den kommenden Jahren wiederhergestellt werden.
Der elegante, zweigeschossige Putzbau hat auf der Hofseite ein Portal, das durch einen Altan und eine Schmuckgaube mit seitlichen Anschwüngen und Rundgiebel betont wird. Dachhäuschen, Eckrustizierung, Traufgesims und die links und rechts des Eingangs in die Fassade eingelassenen Wappen der Grafen von Riaucour (links) und Schall zu Bell (rechts) beleben das Gebäude. Im Schmuckgiebel in Renaissanceformen befindet sich ein Oculus. Ein angrenzendes Ensemble von vier Wirtschaftsgebäuden aus der 2. Hälfte des 18. Jahrhunderts umgibt einen Hof. Das nördliche Gebäude ist eingeschossig und langgestreckt mit Fledermausgauben im Krüppelwalmdach. Verbunden ist es durch einen Torbogen mit drei weiteren, am Berg übereinander gestaffelten Gebäuden mit Krüppelwalmdächern. Der breite, geschwungene Torbogen zwischen den beiden Wirtschaftsflügeln mit großer Durchfahrt und zwei Eingängen trägt das Monogramm des Grafen von Riaucour mit den Initialen "17 GvR 71".
|
|
| |
| Bildergalerie |
|---|
|
 |
| Wasserburg "Kroste" |
|
 |
| Herrenhaus Crostau |
|